Bewertung:
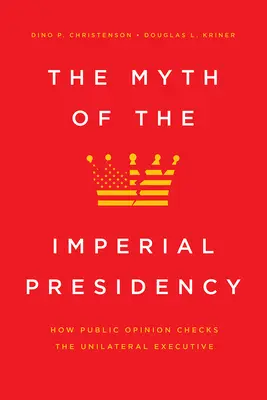
Derzeit gibt es keine Leserbewertungen. Die Bewertung basiert auf 2 Stimmen.
The Myth of the Imperial Presidency: How Public Opinion Checks the Unilateral Executive
Im Laufe der amerikanischen Geschichte haben Präsidenten eine erstaunliche Macht gezeigt, unabhängig vom Kongress und den Gerichten zu handeln. Auf eigene Initiative haben Präsidenten das Land in den Krieg geführt, die Sklaverei abgeschafft, Einwanderer ohne Papiere vor der Abschiebung geschützt, den nationalen Notstand an der Grenze ausgerufen und vieles mehr, was viele dazu veranlasst hat, den Aufstieg einer imperialen Präsidentschaft zu beklagen.
Doch was hält die Präsidenten angesichts der hohen Hürden, die den Kongress und die Gerichte in der Regel daran hindern, einseitige Machtbefugnisse formell zu überprüfen, davon ab, einen noch aggressiveren Alleingang zu wagen? Die Antwort, so argumentieren Dino P. Christenson und Doulas L. Kriner, liegt in der Macht der öffentlichen Meinung.
Anhand solider empirischer Daten und überzeugender Fallstudien zeigen die Autoren, in welchem Maße die öffentliche Meinung im Inland die Macht der Exekutive einschränkt. Präsidenten werden ermutigt, ihre eigene Agenda zu verfolgen, wenn sie eine starke öffentliche Unterstützung genießen, und sie werden eingeschränkt, wenn dies nicht der Fall ist, da einseitiges Handeln die Gefahr birgt, politischen Widerstand hervorzurufen, zukünftige Initiativen zu gefährden und ihr politisches Kapital weiter zu schwächen.
Obwohl nur wenige Amerikaner instinktiv gegen unilaterale Maßnahmen sind, können der Kongress und die Gerichte durch ihre Kritik an unilateralen Maßnahmen die Meinung der Öffentlichkeit beeinflussen. So können andere Zweige die Exekutive immer noch mit politischen Mitteln kontrollieren.
Solange sich die Präsidenten um die öffentliche Meinung kümmern, sind Christenson und Kriner der Meinung, dass die Befürchtungen einer imperialen Präsidentschaft übertrieben sind.